HAWAII, MAUl:
Wie Buckelwale ihre ökologische Nische fanden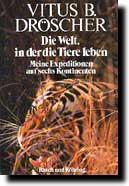
Als der feurige Ball der Sonne im Meer versank, riskierte die Ozeanographin Dr. Katy Payne einen letzten Tauchabstieg. Kaum hatte sie ihre vor der Küste der Hawaii-Insel Maui dümpelnde Segelyacht verlassen, begann das Meer zu vibrieren.
Ein hohler, seltsam melodiöser Klang brachte den Ozean zum Schwingen. Er begann im tiefen Baß, stieg langsam zu höheren Tönen empor, ähnelte für Sekunden dem Duo einer Oboe mit einer gedämpften Trompete und verlor sich nach einer unheimlichen, auf- und abschwellenden Klage wie bei einem melancholischen Dudelsack in tiefem Schweigen.
Der Körper der Forscherin vibrierte mit und versetzte sie in eine Art Weltraumangst, die jedoch von einer überwältigenden erotischen Erregung übertönt wurde, während sich der mächtige Schall am Meeresboden und an der Oberfläche in mehrfachem Echo brach wie in einer riesigen Kathedrale.
Langsam schwamm Katy Payne mit einem Unterwasserscheinwerfer auf die Schallquelle zu. Dann sah sie den Buckelwal, »wie eine Ameise den Elefanten sieht«: ein 17 Meter langes und 45 Tonnen schweres Ungetüm. Im gleichen Augenblick dröhnte die zweite Strophe, wie bei diesen Tieren üblich, mit fest geschlossenem Maul vorgetragen, an die zwanzig Kilometer weit durch den Pazifischen Ozean.
 Die Zoologin und ihr Mann, der international renommierte Walforscher Professor Roger Payne, sind der festen Überzeugung, daß der Gesang dieser einzigen Sänger unter den Walen (unter den Meeressäugern singen nur noch die Bartrobben) der Wahrheitskern einer uralten Legende ist: der von den Sirenen. Dies waren Meerweiber, die einst auf einer sagenhaften Insel im Mittelmeer die vorüber fahrenden Seeleute, wie auch Odysseus, mit betörenden Sirenenklängen anlockten. Waren die Männer gelandet, verwandelten sich die liebreizenden Jungfrauen flugs in menschenfressende Monster von überwältigender Kraft und verspeisten die Seeleute.
Die Zoologin und ihr Mann, der international renommierte Walforscher Professor Roger Payne, sind der festen Überzeugung, daß der Gesang dieser einzigen Sänger unter den Walen (unter den Meeressäugern singen nur noch die Bartrobben) der Wahrheitskern einer uralten Legende ist: der von den Sirenen. Dies waren Meerweiber, die einst auf einer sagenhaften Insel im Mittelmeer die vorüber fahrenden Seeleute, wie auch Odysseus, mit betörenden Sirenenklängen anlockten. Waren die Männer gelandet, verwandelten sich die liebreizenden Jungfrauen flugs in menschenfressende Monster von überwältigender Kraft und verspeisten die Seeleute.
Früher lebten Buckelwale nachgewiesenermaßen auch im Mittelmeer. Mit ihren Liebesliedern ließen sie die hölzernen Schiffskörper vibrieren und versetzten die Matrosen an Bord in jene seltsame erotische Erregung vor rätselhaften Urgewalten. Heute erzeugen allerdings zahlreiche Schiffsmaschinen einen solchen Lärm, daß fast niemand mehr dieses Abenteuer erleben kann. Es sind übrigens tatsächlich Liebeslieder; die männliche Buckelwale erklingen lassen, um die Weibchen aus den Weiten der Weltmeere heranzulocken.
Vier Tage und vier Nächte sang der Koloß fast pausenlos. Dann stellte sich ein etwas größeres, etwa 19 Meter langes Weibchen ein, eng begleitet von seinem einjährigen Kind. Der Bulle bemerkte sofort, daß die »Braut« noch nicht ganz empfängnisbereit war, beschloß aber, sie von nun an ständig gegen andere Männer zu »beschützen«.
Als mehrere Bullen beisammen waren, entbrannte ein regelrechter Sängerkrieg. Alle Bewerber um die Gunst des Weibchens sangen dasselbe Lied, aber nicht im Chor; sondern zeitlich versetzt im Kanon.Die beiden Forscher staunten: Im Jahr zuvor hatten die Wale nämlich ganz andere Melodien vorgetragen. Nach mehrjährigen Beobachtungen fanden sie heraus, was hier gespielt wird:
Die Buckelwale verhalten sich musikalisch wie Teenager mit den Schlagern. In einer Saison ist ein fester Song bei allen der große Hit, und wer ihn am schönsten singt, hat bei den Weibchen die besten Chancen.
 Nach der Brunstzeit verstummen die unterseeischen Schlagerstars für etwa neun Monate, während sie in arktische Seegebiete reisen. Wenn sie sich im folgenden Jahr wieder bei Hawaii (die nordatlantischen Tiere bei den Bermudas) zum Stelldichein treffen, singen sie zunächst das alte Lied. Sie haben also ein gutes Melodiengedächtnis. Bald aber erscheint ihnen der Song zu abgedroschen. Als echte Komponisten des Tierreichs ändern sie erst einige Passagen und, wenn die anderen Wale die Variation übernehmen, allmählich immer mehr. Sie sind in ihrer schöpferischen Phantasie also auch von der Gunst des Publikums abhängig. Obwohl Rivalen im sexuellen Bereich, müssen sie sich im künstlerischen Sektor einig sein. Nach fünf Jahren unterscheiden sich ihre Kompositionen wie die »Beethovens von denen der Beatles«, wie die Paynes es formulieren. Tiere, die Moden kreieren und mit der Mode gehen!
Nach der Brunstzeit verstummen die unterseeischen Schlagerstars für etwa neun Monate, während sie in arktische Seegebiete reisen. Wenn sie sich im folgenden Jahr wieder bei Hawaii (die nordatlantischen Tiere bei den Bermudas) zum Stelldichein treffen, singen sie zunächst das alte Lied. Sie haben also ein gutes Melodiengedächtnis. Bald aber erscheint ihnen der Song zu abgedroschen. Als echte Komponisten des Tierreichs ändern sie erst einige Passagen und, wenn die anderen Wale die Variation übernehmen, allmählich immer mehr. Sie sind in ihrer schöpferischen Phantasie also auch von der Gunst des Publikums abhängig. Obwohl Rivalen im sexuellen Bereich, müssen sie sich im künstlerischen Sektor einig sein. Nach fünf Jahren unterscheiden sich ihre Kompositionen wie die »Beethovens von denen der Beatles«, wie die Paynes es formulieren. Tiere, die Moden kreieren und mit der Mode gehen!
Nach und nach versammeln sich vor der Küste der Insel Maui immer mehr Bullen und Kühe mit ihren Jungen. Bringt der Sängerkrieg keine Entscheidung, wandelt sich das Minnelied zum disharmonischen Droh-Krawall. Plötzlich springt ein Bulle mit seiner 45-Tonnen-Masse aus dem Wasser und klatscht weit hörbar auf die Oberfläche. Das ist das Startsignal zum Imponiertanz der männlichen Wale. Die Kräftigsten wuchten ihren Leib mit der Höchstgeschwindigkeit von 27,6 Kilometern pro Stunde durchs Wasser und springen dann bis zu vierzigmal hintereinander in die Luft. Eine für uns unvorstellbare Kraftdemonstration.
Zu Kämpfen kommt es nur selten. Und die Paarung ist dann auch nur eine Sache von Sekunden. Hierbei erheben sich beide Partner, Bauch an Bauch, mitunter senkrecht aus dem Wasser. Wenn sie zurücksacken, ist die Vorstellung auch schon zu Ende.
Geradezu einzigartig aber sind die Tischsitten der Buckelwale, übrigens so benannt nach dem großen Buckel, den sie an der Meeresoberfläche unmittelbar vor dem Abtauchen in größere Tiefen durch Abknicken des Rückgrats machen. Der Gigant geht auf die Jagd nach winzigen Garnelen.
Zwar jagen Blau-, Finn- und Zwergwal dieselbe Beute. Aber auch sie teilen den »Kuchen« mit Finesse unter sich auf: Der Größte, der Blauwal, schaufelt Garnelen dort in sich hinein, wo sie am zahlreichsten vorkommen: in der Nähe des arktischen oder antarktischen Packeises. Der Zweitgrößte, der Finnwal, macht sich zirkumpolar weiter in Richtung auf die gemäßigten Zonen über die Garnelenschwärme her, die dort allerdings nicht mehr in solcher Größe und Häufigkeit vorkommen. Also muß er viel und weit reisen. Deshalb ist er der Schnellste unter den Bartenwalen. Und deshalb schluckt er auch, wenn er keine Garnelen finden kann, Fische aus Anchovis- oder Heringsschwärmen.
Noch weiter äquatorwärts schließt sich das Garnelenfanggebiet der Zwergwale an, die mit maximal zehn Metern Länge und neun Tonnen Gewicht so zwergenhaft nun auch wieder nicht sind. In ihren Zonen sind die Krill-Krebschen noch seltener, und um so häufiger macht der »Minke«, wie er auch genannt wird, Jagd auf Schwärme von Fischen und Tintenfischen. Je kleiner der Wal, desto größer seine Beutetiere!
Seit die Blauwale durch unverantwortliches Massenabschlachten an den Rand des Aussterbens gebracht wurden, ist in antarktischen Gewässern übrigens eine regionale Verschiebung der Fanggebiete zu verzeichnen. Die zur Zeit noch existierenden etwa 80000 Finnwale und die noch einige Hunderttausende zählenden Zwergwale sind in die einstigen Reviere der Blauwale eingedrungen und profitieren nun von den Krillmengen, die die fast ausgerotteten Riesen nicht mehr nutzen können.
 Doch wo bleibt in dieser Gesellschaft der Buckelwal? Er zieht sich in jene Seegebiete zurück, in denen die Garnelen in so kleinen Schwärmen schwimmen, daß der Blauwal glatt verhungern müßte, wollte er hier jagen. Aber dem Buckelwal ist eine geniale »Erfindung« gelungen, mit der er hier trotzdem existieren kann. Wollte er, wie der Blau- oder Finnwal, den kleinen Garnelenschwarm im Frontalangriff attackieren, würden die winzigen Krebse wie ein Sack Flöhe nach allen Seiten auseinanderstieben. Für den Jäger bliebe so gut wie nichts.
Doch wo bleibt in dieser Gesellschaft der Buckelwal? Er zieht sich in jene Seegebiete zurück, in denen die Garnelen in so kleinen Schwärmen schwimmen, daß der Blauwal glatt verhungern müßte, wollte er hier jagen. Aber dem Buckelwal ist eine geniale »Erfindung« gelungen, mit der er hier trotzdem existieren kann. Wollte er, wie der Blau- oder Finnwal, den kleinen Garnelenschwarm im Frontalangriff attackieren, würden die winzigen Krebse wie ein Sack Flöhe nach allen Seiten auseinanderstieben. Für den Jäger bliebe so gut wie nichts.
Aber ein toller Trick hilft ihm weiter. Der Buckelwal taucht ab, zeigt noch einmal seine Fluke und schwimmt in etwa fünfzig Metern Tiefe unter einen Krebs-Kleinschwarm. Dann zirkuliert er einen Kreis und stößt aus seiner Riesenlunge Luftblasen aus. Diese perlen nach oben und bilden einen hohlzylinderförmigen Vorhang, der die Beutetiere umschließt.
Zwar ist ein Vorhang aus Luftblasen kein undurchdringliches Hindernis, aber eine psychologische Barriere. Seebäder an der südafrikanischen und australischen Küste werden durch am Meeresboden verlegte Rohre, aus denen Preßluft austritt, vor Haien geschützt. Weder Haie noch Kleinkrebse wagen es, durch das Blasengitter hindurchzuschwimmen. Das nutzt der Buckelwal für sich aus. Er schwimmt von unten in seinen drei Meter durchmessenden Luftblasenzylinder hinein, öffnet seinen Oberkiefer, der besser als »Topfdeckel« zu bezeichnen ist, steigt mit weit aufgerissenem Riesenmaul nach oben und schnappt sich alle von seiner Bluff-Methode umzingelten Beutetiere.
 Wenn wir uns noch an den Grauwal erinnern, der Flohkrebse aus dem Sand des Meeresgrundes herausfiltert, um sie zu verspeisen, dann haben wir schon ein gutes Bild von der geradezu unglaublichen Verschiedenartigkeit der Fangmethoden, mit denen sich die Riesen der Meere alle nur erdenklichen Sorten von Kleinkrebsen einverleiben und mit denen sie untereinander ruinöse Konkurrenz vermeiden.
Wenn wir uns noch an den Grauwal erinnern, der Flohkrebse aus dem Sand des Meeresgrundes herausfiltert, um sie zu verspeisen, dann haben wir schon ein gutes Bild von der geradezu unglaublichen Verschiedenartigkeit der Fangmethoden, mit denen sich die Riesen der Meere alle nur erdenklichen Sorten von Kleinkrebsen einverleiben und mit denen sie untereinander ruinöse Konkurrenz vermeiden.
So bliebe der Vollständigkeit halber nur noch anzumerken, welche Fangmethoden Grönlandwal und Nordkaper entwickelt haben. Sie verfügen als Glattwale über ein scheunentorgroßes Riesenmaul. Dieses reißen sie so weit auf, wie es geht, und schwimmen sehr langsam, meist sogar in Familiengruppen mit bis zu fünfzig Tieren in einer breiten Treiberkette, durch ein Seegebiet. Sie bilden also gleichsam eine große Formation von »Schleppnetzen«, in die sich nur vereinzelt Krillkrebse verfangen. Aber nach einigen hundert Seemeilen pro Tag haben sie doch so viel Nahrung in der großen Klappe, daß sie existieren können.